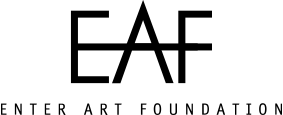Till Wald, Geschäftsführer der Enter Art Foundation, im Gespräch mit Beate Köhne.
Die Malerin Beate Köhne lebt und arbeitet in Berlin-Schöneberg. Seit 2000 sind ihre Gemälde regelmäßig in Ausstellungen zu sehen. Sie erhielt mehrere Stipendien, ihre Werke befinden sich in öffentlichen und privaten Sammlungen im In- und Ausland.
Till Wald: Du malst auf dem Fußboden?
Beate Köhne: Meistens, ja. Ich fange auf jeden Fall erst einmal auf dem Boden an. Das hat viele Vorteile! Wenn ich mit viel Terpentin arbeite entstehen keine Laufnasen. Ansonsten läuft die Ölfarbe ja nach unten, und Schwerkraft will ich in meinen Bildern unbedingt vermeiden. Auf einer liegenden Leinwand kann ich schütten, wischen, schieben wie ich will, und das von allen Seiten. Beim Malen gibt es auch weniger Distanz zu dem, was entsteht, wenn man nicht mit Abstand auf die Leinwand blicken kann. Irgendwann muss ich das Bild zwar von Weitem betrachten und kompositorische Entscheidungen treffen – je weiter es fortschreitet, desto kniffliger wird das ja – aber zunächst darf ich mich gern verlieren. Und solange es noch solche nasse Stellen gibt wie hier, darf man das Bild nicht bewegen.
TW: Heißt das, dass du deine Bilder gar nicht planst und dich eher treiben lässt?
BK: Definitiv. Ich glaube, das mit dem Planen habe ich schon vor 20 Jahren aufgegeben. Es kommt eh etwas anderes dabei heraus. Ich suche Anregungen, das ja, Inspirationen, und das sind bei mir vor allen Dingen Lichtstimmungen. Die Jahreszeiten spielen deswegen eine große Rolle und natürlich auch die Umgebung. Ich bin früher sehr viel gereist und habe auch immer wieder länger im Ausland gearbeitet, in Marokko oder in Mexiko, in Argentinien oder in Island, und diese Bilder hat man ja im Kopf, das wirkt nach. Aus Mexiko habe ich zum Beispiel die dunklen Farben und harten Kontraste mitgebracht, das Licht ist so ungleich härter als bei uns. Und in diesem besonderen Frühjahr 2020 war ich oft frühmorgens in Berliner Parks oder an Seen unterwegs und habe begonnen mit Aquarell auf Leinwand zu malen, mit viel Wasser und mit viel Grün. Da ist eine unerwartet zarte Serie entstanden.
TW: Arbeitest du häufiger in Serien?
BK: Am liebsten. Auch das hilft dabei mir, das einzelne Werk nicht zu wichtig zu nehmen und nicht zu viel darüber nachzudenken, was auf der Leinwand gerade geschieht. Wenn das gelingt entstehen die besten Bilder. Außerdem trocknet Ölfarbe ja sehr langsam. Ich arbeite seit jeher an mehreren Bildern gleichzeitig, weil die Schichten ja auch trocknen müssen. Manchmal vergehen sogar Jahre, bis ein Bild endlich fertig ist. Man darf ihm das bloß nicht ansehen, es soll alles ganz leicht und locker aussehen.
TW: Wie würdest du dein Werk in drei Worten beschreiben?
BK: Leichtigkeit. Dynamik. Natur.
TW: Auf den ersten Blick sehen die Bilder abstrakt aus. Welche Rolle spielt die Natur?
BK: Für mich ist Natur die Konstante, mit der ich mich seit jeher malerisch auseinandersetze. Aber ja, ich stelle fest, dass viele inzwischen zunächst die Abstraktion wahrnehmen. Was selbstverständlich in Ordnung ist. Deswegen nenne ich Natur an dritter Stelle, früher hätte ich sie an die erste gesetzt. Ich glaube, intuitiv nimmt man wahr, dass es organische Linien und Formen sind. Und manchmal taucht ein Blatt auf oder ein Stiel oder eine Pfütze. Eine Sammlerin hat mir gesagt, dass ihr großes Bild wie ein Fenster nach draußen wirkt. Das gefällt mir.
TW: Woran arbeitest du gerade? Abgesehen von der Leinwand auf dem Fußboden?
BK: Und den circa 20 unfertigen Arbeiten auf dem rechten Rollwagen (lacht). Ich versuche gerade, die Extreme noch mehr auszureizen: Ganz dünne Farbe und ganz dicke Schichten, Aquarell und Öl gemeinsam auf einer Leinwand. Weniger Pinsel, mehr Lappen oder geschüttete Farbe. Weniger Kontrolle, mehr Zufall. Aber momentan sitze ich auch viel am Computer, weil ich einen monographischen Katalog vorbereite. Der soll 2021 erscheinen und ich bin schon sehr gespannt darauf.